
Kommunale Wärmeplanung für die Verwaltungsgemeinschaft Lugau und Niederwürschnitz
Was ist die Kommunale Wärmeplanung?
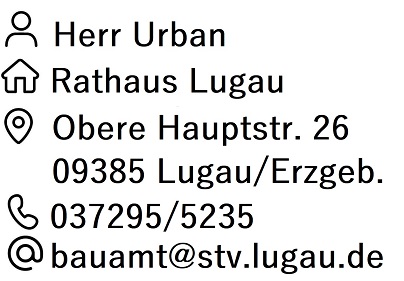
Die Wärmeversorgung macht in Deutschland mehr als 50 Prozent des gesamten Endenergieverbrauchs aus und verursacht einen Großteil des CO2-Ausstoßes. Für eine erfolgreiche Energiewende ist die Umsetzung einer nachhaltigen Wärmeversorgung daher zwingend notwendig. Mit dem Wärmeplanungsgesetz (WPG), das Anfang 2024 in Kraft getreten ist, wurden die Kommunen in Deutschland daher verpflichtet, einen kommunalen Wärmeplan aufzustellen. Dies bedeutet, dass Kommunen zukünftig strategisch planen müssen, wie die eigene Wärmeversorgung zukunftssicher, effizient und umweltfreundlich gestalten werden kann. Hierzu zählt unter anderem die Integration von Erneuerbaren Energien sowie von Abwärmepotenzialen. Zentrales Ziel der KWP ist es, die effizientesten und kostengünstigsten Methoden für eine klimafreundliche Wärmeversorgung vor Ort zu identifizieren. Die KWP ist folglich ein strategisches Planungsinstrument. Sie legt jedoch nicht fest, welche Wärmeversorgung gesetzlich erlaubt ist. Dies regelt das Gebäudeenergiegesetz (GEG), dessen Neuauflage gemeinsam mit dem WPG am 1.1.2024 in Kraft getreten ist. Die wichtigsten Informationen zum GEG finden Sie in unseren FAQ.
Kommunale Wärmeplanung
Auch Lugau und Niederwürschnitz ist durch das Wärmeplanungsgesetz verpflichtet, bis 2028 eine Kommunale Wärmeplanung durchzuführen und vorzulegen. Zur Durchführung der KWP hat die Stadt Fördergelder beim Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) beantragt und bewilligt bekommen (Förderkennzeichen: 67K29218). Mit Erhalt des Förderbescheids wurde der Dienstleisterverbund KWP4 (DBI, INFRACON, IE2S und NeulandQuartier) mit der Erstellung der KWP beauftragt.
Der Leistungszeitraum der KWP beläuft sich auf März 2025 bis Februar 2026. Im Prozess der Kommunalen Wärmeplanung werden neben der Stadt/Stadtverwaltung selbst auch die örtlichen Akteure der Versorgungsunternehmen, der Wohnungswirtschaft sowie des ansässigen maßgeblichen Gewerbes eingebunden. So kann ein zukunftsfähiges Gesamtkonzept für eine kapazitäts- und ressourcenschonende Umsetzung einer klimaneutralen Wärmeversorgung in der Stadt erstellt werden. Die KWP kann jedoch grundsätzlich nur die derzeitige Situation unter Beachtung des aktuellen Standes der Technik und der gegebenen Rahmenbedingungen abbilden.
Zeitplan und Phasen der KWP

Die Erarbeitung einer Kommunalen Wärmeplanung gliedert sich in vier Hauptphasen, die durch den Dienstleisterverbund KWP4 durchgeführt werden. Nach einem Auftakttreffen am 20. März 2025 mit relevanten Akteuren aus Verwaltung, Netzbetreibern und Energieversorgern hat der Dienstleisterverbund KWP4 mit der Durchführung der Bestandsanalyse begonnen. Diese wird voraussichtlich im November fertiggestellt.
Sie möchten einen detaillierten Einblick in die Phasen der Kommunalen Wärmeplanung erhalten? Das Kompetenzzentrum für Kommunale Wärmeplanung (KWW) hat jede Phase in einem eigenen Video gut verständlich aufbereitet. Alle Videos finden Sie hier.
FAQ für die Kommunale Wärmeplanung Verwaltungsgemeinschaft Lugau/Niederwürschnitz
Das übergeordnete Ziel der Kommunalen Wärmeplanung ist die klimaneutrale Wärmeversorgung aller Gebäude. In einem ersten Schritt bedarf es dafür jedoch einer genauen Planung und Abwägung der Möglichkeiten. Nur so kann der Umbau der Wärmeversorgung kontrolliert und erfolgreich durchgeführt werden. Durch die Planung erhalten die wichtigsten Akteure der Wärmewende wie Gebäudeeigentümerinnen und -eigentümer, Wohnungsbaugesellschaften, Energieversorgungsunternehmen, Kommunalverwaltung sowie Unternehmen Orientierung und vor allem Planungssicherheit für die Transformation der Wärmeversorgung. So wird sichergestellt, dass geplant und organisiert umgesetzt werden kann.
Die Kommunale Wärmeplanung (KWP) basiert auf dem bundesweiten Wärmeplanungsgesetz (WPG). Dieses Gesetz verpflichtet Städte und Gemeinden, eine Strategie für eine klimafreundliche Wärmeversorgung zu entwickeln. Allerdings setzen die Bundesländer das Gesetz individuell um. In manchen Bundesländern gibt es bereits eigene Wärmeplanungsgesetze, in anderen – wie in Sachsen – ist die rechtliche Umsetzung noch nicht abgeschlossen.
Die Kommunale Wärmeplanung ist eine rein informelle strategische Planung. Aus dem Beschluss der Wärmeplanung ergibt sich keine Verpflichtung der Kommune, eine bestimmte Wärmeversorgung tatsächlich zu errichten, auszubauen oder zu betreiben. Ebenso ergeben sich aus den Ergebnissen der Kommunalen Wärmeplanung keine rechtlichen Verpflichtungen für die Eigentümer. Der Wärmeplan ist ein informelles Planungsinstrument ohne Rechtswirkung.
Was ist der Unterschied zwischen der Kommunalen Wärmeplanung (KWP) und dem Gebäudeenergiegesetz (GEG)?
Am 1. Januar 2024 sind das Wärmeplanungsgesetz (WPG) und die Novelle des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) in Kraft getreten. Beide Gesetze verfolgen das gemeinsame Ziel, die Wärmeversorgung in Deutschland klimafreundlich zu gestalten, konzentrieren sich dabei aber auf unterschiedliche Ebenen.
- Das Wärmeplanungsgesetz (WPG) gibt Kommunen die Aufgabe, eine Strategie für die künftige Wärmeversorgung zu entwickeln. Dabei werden alle Möglichkeiten berücksichtigt – von zentralen Wärmenetzen bis hin zu dezentralen Lösungen wie Wärmepumpen, Solarthermie oder Geothermie. Ziel ist es, eine langfristige Planung zu schaffen, die an die regionalen Gegebenheiten angepasst ist und dabei möglichst klimaneutral wird.
- Das Gebäudeenergiegesetz (GEG) richtet sich auf die Ebene einzelner Gebäude. Es regelt, welche Heizsysteme in Neubauten oder Bestandsgebäuden eingebaut oder weiterhin genutzt werden dürfen, insbesondere für Gebäude, die nicht an ein kommunales Wärmenetz angeschlossen sind.
Damit schafft das WPG einen Fahrplan für die gesamte Wärmeversorgung einer Kommune, während das GEG die technischen Anforderungen an Heizungen in einzelnen Gebäuden festlegt.
g.
Die Kommunale Wärmeplanung (KWP) untersucht, welche Möglichkeiten es für eine klimafreundliche Wärmeversorgung in unserer Stadt gibt. Sie ist jedoch keine Vorschrift für einzelne Haushalte – sie gibt eine langfristige Orientierung, aber keine direkten Verpflichtungen. Sie entscheiden weiterhin selbst, welche Heizung in Ihrem Gebäude installiert wird, solange sie den gesetzlichen Anforderungen entspricht (GEG).
Das GEG steht, wie weiter oben beschrieben, in keinem direkten Zusammenhang mit der Kommunalen Wärmeplanung (KWP). Dennoch suchen viele Bürgerinnen und Bürger nach Antworten zur Wärmeversorgung, und es gibt Schnittstellen zwischen beiden Gesetzgebungen. Während die KWP eine langfristige Strategie für die kommunale Wärmeversorgung entwickelt, legt das GEG konkrete Anforderungen für Heizsysteme in einzelnen Gebäuden fest.
Für eine fundierte Entscheidung und Informationen zu möglichen Förderungen ist eine Beratung durch zertifizierte Energieberater zu empfehlen. Passende Berater finden Sie auf der Webseite der Energie-Effizienz-Experten der Deutschen Energieagentur (dena).
Laut GEG gilt für bestehende Heizungsanlagen:
- Funktionierende Heizungsanlagen auf Basis fossiler Brennstoffe (z. B. Öl oder Gas) dürfen bis spätestens 2045 weiterbetrieben und bei einem Defekt repariert werden.
- Heizungen, die älter als 30 Jahre sind, müssen gemäß bestehenden Vorschriften ausgetauscht werden. Dies war bereits vor der Novelle des GEG so und bleibt unverändert.
Laut GEG gilt für neue Heizungen – bis zum Abschluss der KWP
- Neubauten in Neubaugebieten: Neue Heizungen müssen mit mindestens 65 % erneuerbaren Energien betrieben werden.
- Neubauten außerhalb von Neubaugebieten und Bestandsgebäude: Hier dürfen vorerst noch alle Heizungstypen eingebaut werden. Ab 2029 müssen sie jedoch schrittweise einen Anteil erneuerbarer Energien einhalten:
- 15 % ab 2029,
- 30 % ab 2035,
- 60 % ab 2040.
Laut GEG gilt für neue Heizungen – nach Abschluss der KWP
- Alle neuen Heizungen in Neubauten und Bestandsgebäuden müssen mit mindestens 65 % erneuerbaren Energien betrieben werden.
- Für defekte Heizungen in Bestandsgebäuden gelten Übergangsfristen:
- Je nach Heizsystem bis zu 13 Jahre,
- bei Anschlussmöglichkeiten an ein Wärmenetz beträgt die Frist 10 Jahre.
Welche Alternativen zu Erdgas- und Ölheizungen soll/kann es zukünftig geben?
Zukünftig stehen verschiedene Alternativen zu Erdgas- und Ölheizungen zur Verfügung, die als klimafreundlich gelten. Dazu gehören:
- Wärmepumpen
- Solarthermie
- Holzheizungen (Pellets, Hackschnitzel, Scheitholz)
- Biomasseheizungen
- Nah- und Fernwärme (z. B. durch Biomasse, Geothermie oder Abwärme)
- Geothermie
- Wasserstoffheizungen
- Hybridheizungen (Kombination mehrerer Technologien)
Welche dieser Alternativen für Lugau in Frage kommen, wird im Rahmen der Kommunalen Wärmeplanung geprüft. Erste Ergebnisse hierzu werden mit der Szenarioanalyse vorliegen. Diese bewertet die Machbarkeit und Wirtschaftlichkeit unterschiedlicher Szenarien und wird voraussichtlich im September 2025 vorliegen.
Nach Abschluss der KWP müssen die Ergebnisse veröffentlicht und vom Stadtrat beschlossen werden. Danach beginnt die Verwaltungsgemeinschaft mit der Planung der empfohlenen Maßnahmen. Dazu werden konkrete Einzelmaßnahmen festgelegt und ein Zeitplan erstellt. In dieser Phase wird auch die Finanzierung der Maßnahmen mit möglichen Fördermitteln geprüft. Insgesamt wird sich die Finanzierung voraussichtlich aus einer Kombination von kommunalen Mitteln, Fördermitteln von Bund und Land sowie privaten Investitionen zusammensetzen. Ziel ist es, die finanzielle Belastung der Bürgerinnen und Bürger durch neue Heizungsanlagen so gering wie möglich zu halten. Nach Prüfung der Finanzierung geht es an die praktische Umsetzung. Weitere Informationen hierzu können erst nach Abschluss des KWP bereitgestellt werden.
Die Kommunale Wärmeplanung wird größtenteils durch Fördergelder des Bundes finanziert, damit die Kosten für die Gemeinden und ihre Bürgerinnen und Bürger möglichst gering bleiben. In der Regel übernimmt das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) bis zu 90 % der Kosten. Die restlichen 10 % trägt die jeweilige Kommune selbst.
Zur Durchführung der KWP hat die Stadt Lugau Fördergelder beantragt und bewilligt bekommen (Förderkennzeichen: 67K29218). Damit werden 90% der Kosten für die KWP gefördert, die restlichen 10% trägt die Stadt Lugau. Mit dieser Kostenaufteilung zwischen Fördermitteln und Eigenanteil wurde der Dienstleisterverbund KWP4 mit der Durchführung der KWP beauftragt.
Die Stadt legt großen Wert auf Transparenz und wird die Bürgerinnen und Bürger während des gesamten Prozesses umfassend informieren. Bürgerinnen und Bürger haben verschiedene Möglichkeiten, sich über die Kommunale Wärmeplanung (KWP) zu informieren und aktiv einzubringen:
- Transparente Informationen: Alle Teilergebnisse der KWP werden regelmäßig auf dieser Webseite unter „Aktuelles“ und im Amtsblatt veröffentlicht.
- Informationsveranstaltung: Eine Bürgerinformationsveranstaltung ist nach derzeitigem Planungsstand für September 2025 nach Abschluss der Szenarioanalyse geplant.
- Möglichkeit zur Stellungnahme: Bevor die Stadt die fertige Wärmeplanung im Stadtrat beschließt, ist sie verpflichtet der Öffentlichkeit die Möglichkeit zu Stellungnahme einzuräumen. Dies kann erst nach Vorliegen der Umsetzungsstrategie erfolgen. Die Umsetzungsstrategie wird voraussichtlich im November 2025